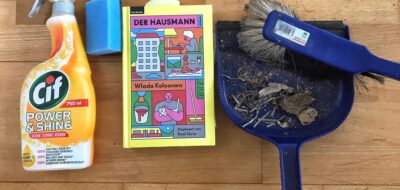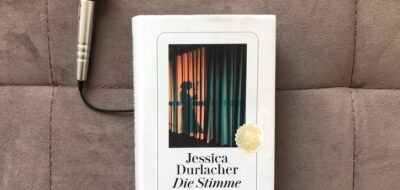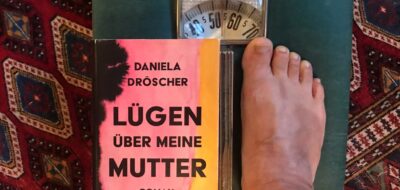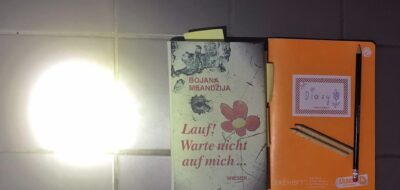Brexit Wutschrift mit Insekten
Das neue Werk ‚Die Kakerlake‘ von Ian McEwan ist nicht nur im Plot, sondern von der Tonalität her völlig anders als all seine bisherigen Werke – zumindest jene, die ich gelesen habe und das waren einige.
Normalerweise beziehen seine Figuren bei moralischen, gesellschaftlichen und politischen Themen unterschiedliche Positionen und diese werden der Leserschaft so ausgewogen präsentiert, dass man sich zumindest einmal mit einer anderen Sichtweise oder den Motiven auseinandersetzen muss und hin und wieder sogar etwas Empathie für die Figuren entwickeln kann, auch wenn sie furchtbare Taten begehen und/oder schlimme Arschlöcher sind. In diesem Roman gibt es aber eine derart eindeutige Tendenz, sodass fast alle Protagonisten böse, intrigant und verschlagen sind, manche aus Berechnung zur Vernichtung und andere aus Dummheit oder Gier.
Zu Beginn der Geschichte startet der Autor mit einer Kafka-Analogie zur Verwandlung. Die Parlamentskakerlake Jim Sams erwacht eines Tages als Mensch – eigentlich als Premierminister von England – und stellt nach einer kurzen Eingewöhnungsphase fest, dass mit ziemlicher Sicherheit auch die meisten anderen Mitglieder des Parlaments allesamt seine Kollegen aus der Kakerlaken-Kolonie sind – bis auf den Außenminister.
Da ja schon von Beginn an klar ist, dass es sich bei dieser Satire um eine Wutschrift gegen den Brexit handelt, war ich sehr unschlüssig, ob sich McEwan hier einen Gefallen getan hat, politische Gegner mit anderen Meinungen als Kakerlaken auftreten zu lassen. Ist dies ein Geniestreich oder ein nicht fertig ausgegorener Schnellschuss der eigenen Verzweiflung?, habe ich mich gefragt.
Die Kritik von einigen Rezensenten auf der Insel an diesem Setting kann ich durchaus nachvollziehen. Deshalb habe ich ein bisschen nach Originalstimmen recherchiert. Der irische Literaturkritiker Fintan O’Toole schrieb etwa im Guardian: „Politische Gegner mit Kakerlaken zu vergleichen, ist eine toxische Metapher mit übler politischer Vorgeschichte, und es ist daher schwer, McEwans Novelle ohne ein gewisses Unbehagen zu lesen.“
Die den Tories nahestehende konservative Wochenzeitschrift The Spectator rügte, es sei unangebracht, demokratisch gewählte Politiker als Kakerlaken darzustellen: „Das war das Wort, mit dem die Völkermörder in Ruanda ihre Anhänger zum Handeln aufriefen.“ (Quelle: Kleine Zeitung)
Dadurch, dass hier aber Kafka von Mc Ewan ganz innovativ geremixed wird – nämlich indem er die Geschichte reversed erzählt (Der Mensch verwandelt sich nicht in eine Kakerlake, sondern die Kakerlake wird zum Menschen) – wird meiner Meinung nach dem Umstand, dass er politische Gegner als Kakerlaken entmenschlicht, durch die Kafka-Analogie die Schärfe genommen. Indem er sich in die Tradition von Orwells Animal Farm und Kafkas Verwandlung einreiht, hat er hier die historische Bombe von Ratten und Kakerlaken im Vorfeld eines Genozids ganz gut entschärft. Er reiht sich ein in den literarischen Brauch, nicht Opfer zu generieren, sondern die herrschende Kaste als Tiere ironisch zu persiflieren. Aber das müsst Ihr natürlich selbst entscheiden, ob das auch für Euch zutrifft. Die Irritationen dazu kann ich selbstverständlich verstehen.
Im Folgenden treten die Kakerlaken in den Hintergrund und uns wird das wahnwitzige politische und volkswirtschaftliche Konzept des Reversalismus vorgestellt, das die britische Regierung durchsetzen möchte. Hierzu werden die Geldflüsse umgedreht, also auch wie Kafkas Verwandlung reversed – welch eine Doppelanalogie – betrachtet.
„Ich habe verzweifelt nach etwas gesucht, das ähnlich absurd wie der Brexit ist. Und bin darauf gekommen, einfach den Geldfluss umzukehren: Arbeitnehmer zahlen dafür, dass sie arbeiten. Kunden kaufen ein und bekommen dafür vom Ladenbesitzer Geld. Das führt zu ziemlich viel Ärger, wenn Sie das auch im internationalen Handel anwenden. Wenn Sie Waren exportieren, müssen Sie dafür dann auch das Geld mitschicken“, sagt McEwan (Quelle: Deutschlandfunk Kultur)
Als Betriebswirtin mit VWL-Ausbildung muss ich aber sagen, dass McEwan sein System in seiner ganzen Beklopptheit sehr stringent, spannend konzipiert und bis zur letzten Konsequenz betriebswirtschaftlich durchexerziert hat. Bargeld darf bei Gefängnisstrafe nicht gehortet und ausgeführt werden, und der Reversalismus funktioniert natürlich langfristig nur, wenn auch der Rest der Welt mitmacht, es sei denn, Großbritannien schottet sich vom Welthandel ab und agiert wirtschaftlich total autark. Dazu müsste man dann auch noch die Grenzen schließen.
„Das erste, überwältigende Problem stellte der Außenhandel dar. Die Deutschen würden gewiss mit Freuden unsere Waren zusammen mit unseren saftigen Geldzahlungen entgegennehmen, doch war wohl kaum anzunehmen, dass sie uns ihre Autos ihrerseits mit Bargeld vollgestopft schickten.“
Die deutsche Kanzlerin und die Leserschaft fragen sich in dieser Satire zu Recht: WARUM? Die Populisten im Land haben aber das einfache Volk, das solche wirtschaftlichen Prämissen, dass 2+2=5 sind, und die Konsequenzen dieser Annahme nicht bis zum Ende durchdenken kann, durch schöne Reden und Medienpräsenz sehr gut unter Kontrolle. Obwohl das Wort Brexit nicht erwähnt wird, zeigt sich hier klar die Analogie.
Der amerikanische Präsident Tupper wird vom britischen Premier insofern korrumpiert und überzeugt, als dass er sich nach geltender Rechtslage durchaus den Verteidigungsetat der gesamten USA in seine eigene Tasche stecken kann. Wenn er will, jenen des Bildungs- und des Gesundheitssystems noch dazu. Ich kenne mich nun mit dem politischen System der Vereinigten Staaten überhaupt nicht aus, aber möglicherweise gibt es da tatsächlich eine Hintertür im System der checks and balances des Landes.
Politische Gegner in Großbritannien werden mit Intrigen und vor allem mit Hilfe der unabhängigen Presse, wie dem Guardian, kaltgestellt. Ein kleiner Seitenhieb auf den politischen Missbrauch der #metoo-Bewegung ist besonders böse. Wir sehen in dieser Geschichte ein Lehrbeispiel, wie politische Ränke zum Schaden des Landes gesponnen, Gesetze und demokratische Regeln ausgehebelt werden.
Am Ende wird noch einmal der Bogen zu den Kakerlaken geschlagen, und dann ergibt sogar der volkswirtschaftliche Wahnwitz dieser Satire einen tieferen Sinn.
Fazit: Ich finde diesen Roman sehr lesenswert, wenngleich es sprachlich bessere Werke des Autors gibt.
Wer sich nicht genauer für die Hintergründe und Implikationen von wirtschaftlichen und politischen Zusammenhängen interessiert, ist hier aber fehl am Platz, denn das Konstrukt dieses fiktiven Britanniens und die satirischen Anspielungen sind diesbzüglich schon etwas für Fortgeschrittene. Insofern kann wahrscheinlich kein einziger Brexit-Befürworter vom Gegenteil überzeugt werden. Aber als Wutschrift in der Verzweiflung gegen die Dummheit und die Ignoranz des Brexit ist er ein sehr spannender, authentischer und vor allem aktueller Diskussionsbeitrag zu diesem Thema.

Impression zum Roman ‚Die Kakerlake‘ von Ian McEwan, Bild (c) Alexandra Wögerbauer-Flicker – kekinwien.at